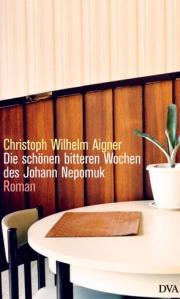Anfang der 1970er Jahre in einer Kleinstadt: Die Deformierung des 17-jährigen Johann Nepomuk Müller durch Schläge und Hunger wird gestoppt durch die Begegnung mit der 24-jährigen Mariella, die im Rollstuhl sitzt. Er rettet sie vor weiteren Übergriffen einer Bande und wird durch die Bekanntschaft mit ihr und ihrem Vater erwachsen.
Zunächst öffnen Vater und Tochter ihm die Augen für die NS-Verbrechen. Mariellas Vater Robert ist ein "Überlebender", er trinkt viel und schreibt an einer Sammlung von Gedichten weiter, die er einst für seine inzwischen verstorbene Ehefrau abgeschrieben hatte und die ihr halfen, das KZ zu überleben. Gedichte und Gespräche über Literatur und Sprache sorgen für die andere große Veränderung im Leben Johann Nepomuks, der bisher nur Schläge, Fußball und das Recht des Stärkeren kannte.
Seit den Geschehnissen, von denen der Ich-Erzähler berichtet, sind sieben Jahre vergangen: Sie werden einerseits in einem Jugendjargon (mit entsprechenden Kraftausdrücken) vorgetragen, der das Geschehene und die damalige Bewusstseinslage (auch durch Präsens) gegenwärtig werden lässt, andererseits distanziert er sie mit philosophisch-reflektierender Sprache. Aigner markiert damit auch sprachlich einerseits die Präsenz des Vergangenen (nichts ist vorbei, gestern ist heute), andererseits die Weiterentwicklung seines Protagonisten durch Zuwendung, Liebe, Sprache, Kunst und Poesie. So weben sich poetische Passagen in diesen Roman, den man - Johann tastet sich an verschiedene Gedichte heran - auch als Einführung in Poesie lesen kann: "In meiner Feldsprache gabs kein Geheimnis, entweder schwieg man, oder man sagte, wie es ist, dazwischen ist nix. Und nun kam mir vor, dass es für das Dazwischen auch was gibt, angreifbar und unangreifbar zugleich ..." (150)
Die Schwarze Pädagogik der Erzieher verknüpft Christoph Wilhelm Aigner mit dem Milieu des Verschweigens der nationalsozialistischen Gräueltaten. Erziehungsmethoden und Mentalitäten wirken weiter, auch dieses Gestern ist heute und lässt sich sprachlich festmachen, etwa in der Terminologie der Professoren, die vom Entsorgen und Aussondern sprechen: "Nun seien wir innert eines Jahres von der besten zur schlechtesten Klasse der Schule verkommen, und er weiß woran das liegt. Es liegt an gewissen dubiosen Elementen, die ihre Wertlosigkeit wie ein fauler Apfel auf die gesunden übertragen. Aber das lässt er nicht zu, der faule Apfel wird ausgeschnitten, ausgesondert." (155)
Am gewagtesten verschränkt Aigner die menschenverachtenden Verhaltensweisen im Kürzel KZ: Die furchtbaren Bilder davon entdeckt Johann Nepomuk in Heften bei seiner Großmutter. Aufschlüsseln müssen sie ihm Mariella und ihr Vater, denn von der Existenz von KZs hat er weder im Geschichtsunterricht noch im Elternhaus gehört, wenngleich er eine Ahnung hatte "von einem weiten gefälschten Land der Mutterversion, aber eben nur eine Ahnung, mich interessierte es auch nicht so brennend, das war alles aus einer Welt vor mir, mit der ich nichts zu tun hatte. Das glaubt man ja gern, dass man mit den Dingen vor einem und hinter einem nichts zu tun haben muss, dass man sie ignorieren kann, woraus der Begriff der Unschuld konstruiert wird." (80) KZ steht aber auch für die Gewalt im Kinderzimmer (366), die das Kind gar nicht als Unrecht erkennt (die Schwarze Pädagogik der Eltern und Lehrer hat beste Arbeit geleistet), obwohl ihm die Schläge des Vaters im wahrsten Sinne des Wortes auf der Haut brennen.
In der kurzen erzählten Zeit, den "schönen bitteren Wochen", wird Johann Nepomuk erwachsen. Er lernt, sich dabei auch von seiner ihm ständig mit Selbstmord drohenden Mutter zu distanzieren. Aigners Romandebüt, das auch auf Huckleberry Finns Abenteuer verweist, verbindet das Thema Erwachsenwerden mit Gesellschaftskritik. Das soziale Feld der Kleinstadt, in deren Topografie - obwohl unbenannt - Leserinnen und Leser die Geburtsstadt Aigners, Wels, erkennen können (auch in manchen literarischen Figuren schimmern konkrete Vorbilder durch), wird in seiner ausschließenden Brutalität beschrieben: Hier die Welt der Ärzte und Notare, die sich alles richten können, und da die Siedlungen der Familien, deren Kinder Fremdkörper in der Schule darstellen, wo sich niemand vorstellen kann, dass die Schrift so unschön ist, weil das Kind vor Hunger den Bleistift nicht halten kann, oder dass der Jugendliche nicht dumm ist, sondern müde - von den Nachtschichten, mit denen er für die Mutter Geld verdient.
Brigitte Schwens-Harrant
Primärliteratur:
Die schönen bitteren Wochen des Johann Nepomuk. München 2006.
Sekundärliteratur:
Axmann, David: "Liiiiie-ba" statt "Hiiiii-bä". Über Christoph Wilhelms Aigners schönen bitteren Roman Die schönen bitteren Wochen des Johann Nepomuk. In: Wiener Zeitung (extra), 4.11.2006. - Kerschbaumer, Sandra: Faustrecht auf dem Bolzplatz. Christoph Wilhelm Aigners kraftstrotzender Jugendroman. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.1.2007. - Längle, Ulrike: An den Hüften vorbei. In: Die Presse (Spectrum), 14.10.2006, IX. - Leister, Judith: Schön bitter. Ein österreichischer Bildungsroman von Christoph Wilhelm Aigner. In: Neue Zürcher Zeitung, 3.2.2007. - Neuber, Sabine: "Wie ein Leben so geht". Christoph Wilhelm Aigner erzählt in bitterem Straßenjargon. In: Neues Deutschland, 20.7.2007. - Polt-Heinzl, Evelyne: C. W. Aigners Romandebut Die schönen bitteren Wochen des Johann Nepomuk. In: Literatur und Kritik 2007, H. 411/412, 99-101. - Schwens-Harrant, Brigitte: Faule Äpfel. Christoph Wilhelm Aigner: Die schönen bitteren Wochen des Johann Nepomuk. In: Dies.: Zerstreute Stimmen. Menschen - Themen - Bücher. Anif/Salzburg 2010, 163-165.